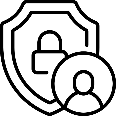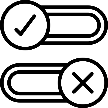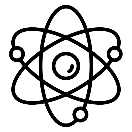Contents
- 1 Was ist organisationale Resilienz?
- 2 Werteorientierung, Ziele und und Sinn
- 3 Anpassungsfähigkeit und Lernbereitschaft
- 4 Transparente Kommunikation und psychologische Sicherheit
- 5 Strukturelle Flexibilität und Redundanz
- 6 Beziehungs- und Bindungsqualität
- 7 Selbstorganisation und Eigenverantwortung
- 8 Zukunftsorientiertes Denken und nachhaltige Strategie
- 9 Sie möchten wissen, wie resilient Ihr Unternehmen ist?
Die Definition von „Resilienz“ hat sich gewandelt. Organisationale Resilienz ist ein Wettbewerbsvorteil, wenn Sie auch unter unvorhersehbaren Rahmenbedingungen die Leistungsfähigkeit hochhalten und Innovationen vorangetrieben werden. Viele Untersuchungen zeigen, dass organisationale Resilienz zu einer wichtigen Quelle für Umsatzwachstum und Rentabilität geworden ist, insbesondere auf lange Sicht.
Was ist organisationale Resilienz?
Resilienz beschreibt die Fähigkeit eines Systems, sich trotz widriger Umstände erfolgreich anzupassen, Krisen zu bewältigen und gestärkt daraus hervorzugehen. Grade die organisationale Resilienz, also die Fähigkeit eines Unternehmens, unter Druck stabil zu bleiben, schnell zu lernen und sich weiterzuentwickeln – ohne die eigene Identität zu verlieren wächst an Bedeutung.
Dabei geht es nicht nur um das Überstehen von Krisen, sondern um eine aktive Widerstandsfähigkeit im Alltag die sich an 7 zentralen Resilienzfaktoren festmachen lässt, die sich in Kultur, Strukturen und Führungsverhalten zeigen.
In diesem Blogartikel beschreibe ich die 7 Schwerpunkte für organisationale Resilienz so, dass Sie auch mit konkret umsetzbaren Beispielen verbunden ist. Anhand von Fragen können Sie erkennen, wie gut Sie in einzelnen Feldern bereits organisationale Resilienz in Ihrem Unternehmen verankert haben.
Werteorientierung, Ziele und und Sinn
Mitarbeitende und Führungskräfte wissen, wofür sie etwas tun. Klare Werte und Ziele wirken sinnstiftend und handlungsleitend. Die Werte und Ziele sind dabei nicht am Papier, sondern klar in den täglichen Alltag integriert, sodass jeder Mitarbeitende genau erkennt, an welchem Punkt seiner Arbeit einzelne Werte oder Ziele greifbar sind. Die Mitarbeitenden können diese bei Nachfrage jederzeit benennen und auch konkret angeben, woran Sie bei ihrer Arbeitsleistung das Fehlen der Verbindung zu Werten und Zielen erkennen würden.
Anpassungsfähigkeit und Lernbereitschaft
Organisationen, die in Feedbackzyklen denken, experimentieren und iterieren, können sich schneller an neue Anforderungen anpassen. Schneller Wandel braucht die Beteiligung jedes Einzelnen, um ein möglichst breites Portfolio an Perspektiven zu haben, um Ideen auszuprobieren, zu evaluieren und aus dem Feedback schnell Schlüsse zu ziehen. Engmaschiges Feedback ist dabei keine Bremse, sondern unterstützt, auf die blinden Flecken des jeweiligen Gegenübers zu schauen mit dem Ziel, voneinander zu lernen. Wichtig dabei ist, dass Sie entsprechende Strukturen schaffen, dass gezieltes Feedback nicht nur von oben nach unten, sondern aus allen Richtungen erfolgt. Achten Sie darauf, dass Fedbackschleifen so eingerichtet werden, dass Feedback zeitnah erfolgen kann.
Ganz konkret sollten Sie jede Woche 10 Minuten 1:1 Zeit mit Ihren wichtigsten Direct-reports einplanen, um den aktuellen Projektstatus zu besprechen, aber auch die emotionale Lage zu erfragen und konkrete Unterstützung anzubieten. Das gilt in weiterer Folge auch für jede Führungskraft in Ihrer gesamten Organisation.
Transparente Kommunikation und psychologische Sicherheit
Offenheit, aktives Zuhören und eine gelebte Fehlerkultur schaffen Vertrauen – die Basis jeder Resilienz. Das Funktionieren einer lebendigen Lernkultur erkennen Sie daran, dass Mitarbeitende jederzeit bereit sind, Ideen einzubringen und auch sicher sein können, dass ihre Ideen mit Offenheit angehört und diese diskutiert werden. Die Transparenz und Offenheit fördern Vertrauen und die Bereitschaft der Teams, auch riskantere Ideen einzubringen, auch wenn diese nicht sofort zum Erfolg führen, lernen Sie aus den neuen Erkenntnissen, ohne zu Verurteilen.
Nach jedem abgeschlossenen Projekt bietet sich ein Recap Termin an, in dem alle Teammitglieder ihre fachlichen und persönlichen Erfahrungen mit einbringen, mit dem Ziel für die nächsten Projekte Learnings zu sammeln. Regelmäßige Übung fördert besonders die organisationale Resilienz.
Strukturelle Flexibilität und Redundanz
Unternehmen mit schlanken, aber flexiblen Prozessen können schnell reagieren. Redundanzen in Know-how und Aufgabenverteilung sichern Handlungsfähigkeit im Krisenfall. Stellen Sie sicher, dass Fachwissen im Unternehmen aktiv geteilt wird, sodass Sie im Bedarfsfall auf ein Netzwerk an WissensträgerInnen zurückgreifen können und/oder eine permanent gut gepflegte Wissensdatenbank aufbauen. Die Pflege und Dokumentation von Spezialwissen ist im Alltag unsexy und oft bleibt dafür keine Zeit, fällt aber eine Fachkraft auch nur wenige Tage aus, oder verlässt unerwartet das Unternehmen, so haben Sie eine Übergangsfrist von 48 Stunden statt einen mehrere Wochen dauernden Stillstand
Gerade in diesem Bereich brauchen Sie ein funktionierendes Frühwarnsystem, das auch und gerade Überlastung im Blick hat. Ein funktionierendes Buddy System kann helfen, frühzeitig Herausforderungen zu erkennen und organisationale Resilienz aufzubauen.
Beziehungs- und Bindungsqualität
Resiliente Organisationen fördern stabile Beziehungen – innerhalb von Teams, zwischen Hierarchieebenen und mit externen Partnern. Bindung und Beziehung sollten Sie tatsächlich in den Mittelpunkt stellen und als Basis für die Entwicklung von Resilienz im Unternehmen sehen. Denn: ohne diese Grundpfeiler sind alle anderen Bemühungen auf keinem tragfähigen Fundament.
Fragen oder hinterfragen Sie als Firmenchef, wo Vertrauen im aktuellen Zusammenleben im Unternehmen entsteht, und wo dieses gebrochen wird? Wie erleben Ihre Mitarbeitenden die aktuelle Qualität der Beziehung? Welche Haltungen im aktuellen Zusammenleben im Unternehmen fördern Bindung und welche verhindern diese auch?
Auch die Strukturen im Unternehmen können Beziehungen fördern oder verhindern. Gibt es abseits von Funktion und Rolle Räume, die echtes Miteinander fördern? Sind die aktuellen Prozesse auf die systematische Stärkung von Verbindungen ausgelegt, oder hemmen diese eher einen offenen Austausch?
Wie stark wird Beziehung von Ihren Führungskräften getragen und gelebt, oder ist Beziehungsarbeit nur ein nice to have und bleibt im Unternehmensalltag dafür einfach keine Zeit?
Wenn Ihnen bei all diesen Fragen der Kopf raucht und Sie dazu tendieren, mit dem Lesen aufzuhören, biete ich Ihnen gerne Unterstützung an, denn klar, all die Fragen zu beantworten und auch aktiv hinzuschauen braucht Zeit. Gerade dann, wenn Sie nicht hinter all diesen Fragen einen Haken setzen können, geht organisationale Resilienz nicht von heute auf morgen. Dann sehen Sie aber, dass wesentliche Teile Ihres Unternehmens nicht die Voraussetzung erfüllen, in herausfordernden Zeiten resilient zusammenzuwirken und Ihr Unternehmen nach vorne zu bringen.
Dann sollten Sie genau jetzt aktiv werden, denn fehlende Bindung und Beziehung kostet Sie täglich Geld – in steigenden Krankenständen, hohen Fluktuationsraten und steigenden Recruitingkosten – gerade bei den Schlüsselkräften. Sie sind es, die zunehmend einfordern, in einer Kultur zu arbeiten die bereichert, statt zu schwächen. Und ja, KI braucht keine Bindung und Beziehung, aber die Intelligenz in Ihrem Unternehmen und die Weiterentwicklung treiben immer noch Menschen.
Bei Bindung und Beziehung gilt es, noch eine weitere Hürde zu überspringen: Die Fragen zu Bindung und Beziehung dürfen nicht nur aus Ihrer Sicht ein Häkchen bekommen, sondern müssen aus Sicht der Mitarbeitenden spürbar sein.
Bindung und Beziehung sind nämlich die Grundlage, dass Vertrauen erst entstehen kann.
Ohne Vertrauen sind die Mitarbeiter nicht bereit Verantwortung zu übernehmen oder riskante Entscheidungen zu treffen.
Selbstorganisation und Eigenverantwortung
Mitarbeitende, die eigenständig handeln dürfen, erleben Selbstwirksamkeit – ein Schlüsselfaktor für organisationale Resilienz. Für die meisten Ihrer Projekte und Prozesse kann es sinnvoll sein, dass jede Person im Team eine bestimmte Rolle innehat und selbst entscheidet, welche Schritte bis wann zum Gelingen des Gesamtprojektes oder -zieles nötig sind. Dafür ist es notwendig die Rollen klar zu definieren und festzulegen, was genau in die Verantwortung der/des Einzelnen fällt, welche Entscheidungen selbst zu tragen sind und ab welchem Punkt die Verantwortung eines anderen beginnt bzw. wo die Grenzen des eigenen Entscheidungsspielraumes liegen. Aufgaben innerhalb der eigenen Rolle selbst zu organisieren und zu verwalten sind die eine Seite der Medaille – reine Selbstorganisation, verbunden mit der Leistungsfähigkeit der ausführenden Person.
Echte Selbstwirksamkeit erreichen Sie bei der oder dem Mitarbeitenden aber erst dann, wenn er oder sie auch versteht, welchen Beitrag zum Gelingen des Gesamtprojektes er/sie beiträgt und dieser entsprechend wertgeschätzt und anerkannt wird. Erst dann sehen Mitarbeitende, dass sie durch ihre Arbeit Wirkung erzielen können, die einen entsprechenden Impact leistet – die Ebene der Leistungsbereitschaft ist erreicht. Dies zu vermitteln, benötigt permanente Kommunikation.
Darüberhinausgehend die Verantwortung für die eigenen Handlungen und Entscheidungen im Sinne der Eigenverantwortung zu tragen, braucht nicht nur Kommunikation, sondern auch die Sicherheit, dass Fehler keine negativen Konsequenzen haben und auch die Offenheit besteht, über Fehler aktiv sprechen zu können. Diesen Grundstein haben Sie in der Erfüllung der obigen Punkte gelegt. Hier erleben Sie die unmittelbare Rückkoppelung, denn nur dann, wenn psychologische Sicherheit erlebt wird, tragen Menschen die ihnen zugedachte Verantwortung ohne permanente Absicherung und zeitintensive Rückkoppelung.
Zukunftsorientiertes Denken und nachhaltige Strategie
Zukunftsorientierung und die Verankerung von Nachhaltigkeit hilft dabei, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Setzen Sie langfristige Ziele, verbunden mit einer klaren Vision: Die Fähigkeit ermöglicht Ihrem Team, kurzfristige Rückschläge im Kontext einer größeren Perspektive zu betrachten. Dies kann dazu beitragen, durch schwierige Zeiten hindurchzuhalten. Nachhaltige und zukunftsorientierte Strategien werden durch eine gelebte Kultur getragen, die Vertrauen, Beteiligung und Verantwortung fördert. Das erhöht die innere Stärke und Flexibilität von Mitarbeitenden und Organisation. Menschen die in Ihrem Unternehmen, die in die Zukunft schauen können, sind besser in der Lage, sich anzupassen und neue Strategien zu entwickeln, um mit unvorhergesehenen Umständen umzugehen
Organisationale Resilienz kommt nicht von selbst – aber sie ist lern- und entwickelbar. Die gute Nachricht: Organisationen können systematisch daran arbeiten. Und die Investition zahlt sich aus – nicht nur in Krisen, sondern vor allem im alltäglichen Wettbewerb um Talente, Aufmerksamkeit und Vertrauen.
Sie möchten wissen, wie resilient Ihr Unternehmen ist?
Kontaktieren Sie uns – wir unterstützen Sie bei der Analyse, dem Aufbau und der Stärkung Ihrer organisationalen Resilienz.