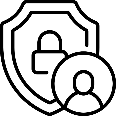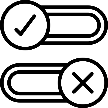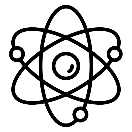Interview mit Patrick Mocker, Business Continuity Manager (Barmherzige Brüder, früherer Einsatzbeamter beim Einsatzkommando COBRA)
Es gibt Gespräche, die beginnen leise und entwickeln im Laufe der Zeit eine erstaunliche Tiefe. Dieses Interview ist eines davon. Mit Patrick Mocker tauche ich in die Denkweise eines Menschen, der gelernt hat, unter außergewöhnlichen Bedingungen Verantwortung zu tragen – und heute genau dieses Wissen in völlig neue Systeme einbringt.
Herr Mocker blickt auf zwei sehr unterschiedliche Welten: fast zwei Jahrzehnte in einer polizeilichen Spezialeinheit – einer Umgebung, in der Unsicherheit, Druck und komplexe Entscheidungen Alltag sind – und sein heutiges Arbeitsfeld in medizinischen Einrichtungen, wo Stress oft eine andere Form hat, aber in seiner Intensität nicht weniger relevant ist. Dazwischen eine bemerkenswerte Reflexionsfähigkeit und eine große Portion Menschlichkeit.
Wie Stress wirkt – und warum wir oft genau falsch reagieren
Wenn Herr Mocker über Stress spricht, tut er das ohne Pathos, aber mit eindrucksvoller Klarheit. „Stress ist nichts Bedrohliches per se“, sagt er, „sondern ein biologisches System, das uns schützen soll. Das Problem beginnt dort, wo Stress zum Dauerzustand wird und das limbische System – der archaische Teil unseres Gehirns – das Kommando übernimmt.“
Dann passiert genau das, was jeder von uns schon selbst erlebt hat: Der Mensch beschleunigt. Er handelt, bevor er denkt. Er reagiert, statt zu reflektieren. Viele kennen dieses Muster – aus Meetings, in denen man zu schnell zusagt, aus Situationen, in denen man sofort antwortet, obwohl ein kurzer Moment des Nachdenkens mehr gebracht hätte.
Herr Mocker bringt ein Beispiel, das sicher alle nachvollziehen können: die Erste-Hilfe-Situation. Ein Mensch liegt am Boden, bewusstlos. Die intuitive Reaktion vieler ist: hinspringen, anpacken, sofort etwas tun. Doch medizinisch gesehen ist oft das Gegenteil hilfreicher: zehn oder fünfzehn Sekunden innehalten, tief durchatmen, überlegen, was zu tun ist.
„In diesen wenigen Sekunden stirbt niemand“, sagt Herr Mocker. „Aber man gewinnt Klarheit, und die entscheidet über die Qualität des Handelns.“
Dieser Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch seine Haltung: Die wichtigste Fähigkeit im Stress ist nicht Geschwindigkeit, sondern Bewusstheit. Und genau das ist trainierbar – egal ob in einer Spezialeinheit oder in einem Büro.
Fokus statt Multitasking – klare Entscheidungen statt Überforderung
Eine seiner wichtigsten Erkenntnisse klingt einfach, ist aber für viele im Arbeitsalltag ungewohnt: Er macht nie mehrere Dinge gleichzeitig.
„Immer nur ein Task zur Zeit“, sagt Herr Mocker. „Und erst wenn der abgeschlossen ist, kommt der nächste.“
Das hat nichts mit Starrheit zu tun. Er beschreibt seinen aktuellen Arbeitstag als flexibel – aber strukturiert. Ein klarer Plan, der sich verschieben darf. Ein Rahmen, der sich anpasst, ohne zu zerfallen.
Multitasking sieht er hingegen als zentrale Fehlerquelle der modernen Arbeitswelt. Viele Arbeitsplätze sind so organisiert, dass Menschen gleichzeitig sprechen, tippen, denken, planen und Entscheidungen treffen müssen. „Das überfordert das Gehirn“, sagt Herr Mocker, und führt zu Stress, den wir als „normal“ missverstehen.
Sein Ansatz ist radikal pragmatisch: Wer Komplexität bewältigen will, muss sich selbst entlasten.
„Ich weiß, dass ich nur eine begrenzte Kapazität habe. Warum also sollte ich sie künstlich überlasten?“
Unsicherheitstoleranz – die Fähigkeit, im Unbekannten ruhig zu bleiben
Einer der spannendsten Begriffe, die er einführt, ist „Unsicherheitstoleranz“.
Er meint damit die Fähigkeit, Situationen auszuhalten, die nicht planbar sind.
In seiner früheren Arbeit in der Polizeispezialeinheit war das Alltag. Zugriffssituationen, die sich in Sekunden ändern konnten, Verhandlungen, die kippen konnten, Stresslagen, in denen man gleichzeitig wach, klar und beweglich bleiben musste.
Er beschreibt dieses Arbeitsumfeld überraschend unheroisch. Es klingt eher wie ein sehr präzises Zusammenspiel vieler Individuen, die gelernt haben, sich und die anderen zu kennen. Die Kunst besteht darin, flexibel zu bleiben – nicht im Sinne von Chaos, sondern im Sinne eines Systems, das sich dynamisch anpassen kann, ohne zu brechen.
Was ihn besonders geprägt hat: Man trainiert so lange, bis das Unbekannte nicht mehr erschreckt. Bis neue Situationen nicht Panik auslösen, sondern Präsenz. Herr Mocker erklärt: „Man muss lernen, sich selbst nicht zu verlieren, nur weil sich außen alles verändert.“
Eine Methode, die Herr Mocker besonders schätzt: die Life-Kinetik. Es ist eigentlich ein Konzept aus dem Leistungssport, ein psychomotorisches Training, bei dem man über gleichzeitige kognitive und motorische Aufgaben das Gehirn anregt, neue Verbindungen zu bilden. Die Idee dahinter ist simpel und trotzdem faszinierend – durch Überforderung, die man gezielt steuert, entsteht Stress, aber ein positiver, anregender Stress, der das Gehirn zwingt, sich neu zu vernetzen. Neurobiologisch ist das Ziel, ein möglichst dichtes Netzwerk im Gehirn zu schaffen. Je mehr Synapsen, desto besser kann das System reagieren. Es geht gar nicht darum, einzelne Hirnareale gezielt zu trainieren, sondern um die Vielfalt – je abwechslungsreicher die Übungen, desto dichter das Netz.
Diese Fähigkeit, sagt er, sei heute überall gefragt – in der Medizin, in Teams, in Führung. Unsicherheit ist kein Ausnahmezustand mehr, sondern Alltag. Und wer sie gut regulieren kann, bleibt handlungsfähig.
In seiner aktuellen Rolle bei den Barmherzigen Brüdern ist Herr Mocker für das Business-Continuity-Management zuständig – das heißt, er bereitet die Organisation darauf vor, auch in Krisen funktionsfähig zu bleiben. „Zum Beispiel, wenn Computersysteme ausfallen, damit wir trotzdem weiterarbeiten können“, erklärt Herr Mocker. Ich sehe das stark von der organisatorischen Seite her: Menschen müssen wissen, was zu tun ist, auch wenn Technik versagt. Ich arbeite dabei eng mit Psychologen und IT-Experten zusammen, weil Widerstandsfähigkeit immer eine Frage von System und Mensch zugleich ist.
Teamkultur: Vertrauen, Verletzlichkeit und gegenseitige Verantwortung
Ein großes Thema in unserem Gespräch ist Teamkultur.
Er erzählt, dass in seiner früheren Einheit ein sehr starkes Wir-Gefühl herrschte – als bewusste Grundlage professioneller Zusammenarbeit.
„Wir mussten uns aufeinander verlassen können. Nicht nur technisch, sondern emotional“, ergänzt Herr Mocker. Ist jemand privat belastet, hat jemand einen schweren Verlust oder eine Krise, wird die Person geschützt, angepasst eingesetzt, entlastet.
Hier treffen sich seine Erfahrungen mit jenen aus dem medizinischen Alltag: Teams, die einander wirklich wahrnehmen, funktionieren anders. Sie sind stabiler, verlässlicher und vor allem resilienter.
Ich sehe da viele Parallelen zur Medizin, vor allem in der Pflege. Dort arbeiten Teams, die ständig unter Druck stehen, mit unvorhersehbaren Situationen umgehen müssen. Der Unterschied ist nur: In der Pflege wechseln die Teams ständig, man kennt sich oft nicht gut genug, um wirklich blind aufeinander vertrauen zu können.
Diese Form von Achtsamkeit fehlt ihm in vielen Organisationen. „Wenn jemand im Team nicht gut drauf ist, betrifft das die ganze Gruppe“, sagt er. „Und trotzdem trauen sich viele nicht, sich verletzlich zu zeigen“ oder zu sagen: „Mir ist das grad zu viel“. Verletzlichkeit zu zeigen, ist eine echte Stärke in Teams.
Er findet es wichtig, dass Teams lernen, diese Veränderungen wahrzunehmen, dass man erkennt, wann jemand überfordert ist, auch wenn er es selbst nicht zugibt. In Extremsituationen zeigt sich, wer wir wirklich sind – oder wer wir glauben zu sein. Nicht jede/jeder wird unter Druck leiser. Manche werden lauter. Manche ziehen sich zurück. Andere werden hektisch.
Diese Veränderungen zu erkennen – und richtig zu deuten – ist zentrale Führungsarbeit und zugleich ein Zeichen guter Kollegialität.
Führung bedeutet Orientierung zu geben, statt Kontrolle auszuüben
Er spricht viel über Führung – und überraschend wenig über Hierarchie. Obwohl er aus einem streng organisierten System kommt, beschreibt Herr Mocker Führung als etwas, das mit Freiheit zu tun hat.
„Ein klarer Rahmen, aber innerhalb davon viel Selbstständigkeit“, sagt er.
Man kann es tatsächlich als eine Art „Montessori für Erwachsene“ verstehen: (Ein klarer, fester Rahmen, in dem aber maximale Eigenständigkeit gefordert ist. Jeder weiß, was das Ziel ist, aber der Weg dorthin ist individuell.) Regeln, die Sicherheit geben, und Räume, die Kreativität ermöglichen.
Führung bedeutet für ihn vor allem, Menschen so einzusetzen, wie sie sind – nicht wie sie sein sollten.
„Die Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied“, sagt Herr Mocker und meint damit, nicht im Sinne von Defiziten, sondern im Sinne von Verantwortung: Wenn jemand eine Schwäche hat, muss das Team das ausgleichen. Wenn jemand eine Stärke hat, soll sie genutzt werden.
Er bringt Beispiele:
Der rhetorisch starke Kollege war Erstansprecher für Geiselnehmer.
Jemand mit Sprachenkenntnissen wird in Situationen eingesetzt, in denen kulturelle Barrieren relevant sind.
Andere hatten körperliche Vorteile oder analytische Fähigkeiten.
Diese Haltung überträgt er heute in seine Arbeit mit Führungskräften:
Gute Führung erkennt Potenziale – und hat den Mut, Menschen in ihren Stärken arbeiten zu lassen.
Und: Wenn ich sage, „die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied“, dann bin ich selbst Teil dieser Kette. Ich kann mich über Umstände ärgern, aber am meisten bewirken kann ich, wenn ich bei mir anfange. Das habe ich in all den Jahren gelernt – ich kann nicht alles kontrollieren, aber ich kann immer an meiner eigenen Haltung und Performance arbeiten.
Der persönliche Blick: Optimismus und die Fähigkeit, Dinge zu beenden
Wir sprechen auch über seinen persönlichen Umgang mit Veränderung.
Herr Mocker spricht sehr klar darüber, dass jedes Kapitel ein Ende haben darf – sogar eines, dass man geliebt hat. Er sagt: „Ich vermisse meine alte Arbeit nicht. Nicht, weil sie schlecht war, sondern weil sie vorbei ist. Und das ist gut so.“
Endlichkeit als Voraussetzung für Entwicklung.
Sein Blick macht Mut, weil er zeigt, dass Veränderung nicht Verlust bedeutet, sondern Wachstum.
Herr Mocker beschreibt sich selbst als Optimisten, manchmal sogar als „ewigen Optimisten“.
Nicht blauäugig, sondern pragmatisch: „Optimismus ist ein Werkzeug. Er eröffnet Räume.“
Die Brücke in den Alltag: Was Unternehmen heute daraus lernen können
Was dieses Gespräch so wertvoll macht, ist die Erkenntnis, dass die Mechanismen von Hochstresssituationen nicht exklusiv Einsatzkräften vorbehalten sind.
Auch in Büros, in Krankenhäusern, in Projektteams wirken dieselben Muster:
- Menschen handeln zu schnell.
- Teams übersehen Überforderung.
- Multitasking zerstört Fokus.
- Unsicherheit erzeugt Stress.
- Führung versucht zu kontrollieren, statt zu orientieren.
- Kommunikation wird enger, wenn der Druck steigt.
Herrn Mocker bringt zwei Welten zusammen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben und im Kern doch identisch funktionieren:
Der Mensch bleibt Mensch – auch unter Druck. Und genau dort entscheidet sich, wie leistungsfähig ein System wirklich ist.
Sein persönlicher Ausgleich:
Wenn ich Peak Phasen habe, nutze ich körperlichen Ausgleich, körperlicher Abbau hat schon einen absoluten Mehrwert.
Ein Boxsack
Die Klimmstange im Büro – ich mache ein paar Klimmzüge und die Kollegen kommen zum „Aushängen“ vorbei.