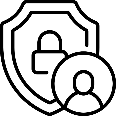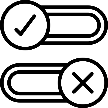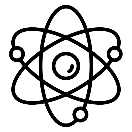Interview Karl Heinz Busch – Head of Organizational Learning and Transition – Lean/Agile Transformation Siemens Development System – Digital Industries Factory Automation – Siemens AG.
Im Gespräch mit Karl Heinz Busch wird deutlich, wie viel ungenutztes Wissen und wie viele Fähigkeiten in Unternehmen verborgen bleiben – und wie stark Strukturen, Rollenbilder und Geschwindigkeit verhindern, dass diese Potenziale sichtbar werden.
Er beschreibt ein Phänomen, das viele Organisationen kennen: Mitarbeitende, die außerhalb des Unternehmens selbstbewusst, kreativ und lösungsorientiert agieren, legen beim Betreten des Arbeitsplatzes sprichwörtlich eine „Maske“ an. Statt in ihrer vollen Kraft zu wirken, passen sie sich formalen Erwartungen, Prozessen und Rollen an. Dadurch bleiben Kompetenzen, Kreativität und Leidenschaft im Arbeitsalltag oft unsichtbar.
In großen Organisationen verstärken standardisierte Skill-Datenbanken, Prozessvorgaben und Hierarchien dieses Problem. Menschen werden in Kategorien eingeordnet – doch das, was sie wirklich ausmacht, zeigt sich erst, wenn sie ausreichend Raum bekommen, sich zu zeigen. Genau dieser Raum fehlt heute vielerorts. Ständige Umstrukturierungen, Effizienzdruck und Projektverdichtung lassen kaum Zeit, innezuhalten und zu fragen:
„Was können wir eigentlich schon – und wie nutzen wir unsere Stärken besser?“
Orientierung in Zeiten des Wandels
Gerade in Transformationsphasen wird dieser Mangel besonders spürbar. Herr Busch schildert eine aktuelle Reorganisation in seiner Produktentwicklungseinheit mit rund 4.000 Mitarbeitenden. Neue Strukturen entstehen, doch viele Mitarbeitende wissen noch nicht genau, was ihr zukünftiger Auftrag ist – auch Führungskräfte nicht.
In dieser Phase gehe es darum, Orientierung zu schaffen – nicht nur durch Organigramme oder Prozesse, sondern durch Dialog. Teams nutzen Workshops, um sich neu zu verorten: „Was ist unser gemeinsamer Zweck? Wozu tragen wir bei?“ Solche Prozesse brauchen Zeit, denn echte Neuaufstellungen gelingen nicht über Nacht. Erst wenn Teams diese Fragen gemeinsam beantworten und neue psychologische Verträge aushandeln, entsteht wieder Klarheit und Energie.
Eine zentrale Herausforderung sieht Herr Busch in der Balance zwischen Struktur und Freiheit:
„Prozesse sind wichtig, um Orientierung zu geben – aber sie dürfen nicht zu starren Regeln werden, die Eigeninitiative lähmen.“
Er plädiert für das, was er „brauchbare Illegalität“ nennt: die Fähigkeit, pragmatisch zu handeln, sich über starre Vorgaben hinwegzusetzen und Lösungen zu finden, die für Menschen funktionieren. Wissen, Vertrauen und Begeisterung entstehen nicht durch Kontrollstrukturen, sondern durch Begegnung. Seine Aufgabe sieht er darin, Räume zu schaffen, in denen Menschen ihre Stärken zeigen, Wissen teilen und voneinander lernen können.
Empowerment als Haltung
„Menschen sollen sich trauen zu handeln, auch wenn nicht alle Rahmenbedingungen feststehen.“
Im oben angesprochenen Umstrukturierungsprozess berichtet ihm ein Mitarbeiter, dass sein Team keine klaren Vorgaben von der Führung erhalte. Statt in Passivität zu verfallen, begann er gemeinsam mit Kollegen, Themen zu priorisieren und Aufgaben zu strukturieren. Herr Busch bestärkte ihn darin:
„Du machst genau das Richtige – du übernimmst Verantwortung, du gehst in Führung, du nimmst andere mit“.
Empowerment bedeutet für ihn erlauben und verstärken: Menschen sollen nicht auf Erlaubnis warten müssen, um aktiv zu werden. Zugleich müssen Führungskräfte lernen, solche Initiativen anzunehmen und zu fördern. Viele Führungskräfte suchen selbst nach Orientierung – konkrete Vorschläge „von unten“ können ihnen Sicherheit geben, bis klarere Strukturen entstehen. So entsteht gegenseitiges Empowerment – von unten nach oben und von oben nach unten.
„Manchmal weiß es der Chef auch nicht besser – und das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass Bewegung entsteht.“
Herr Busch versteht Empowerment als Grundhaltung, die Verantwortung ermöglicht, Vertrauen stärkt und Wandel auf allen Ebenen vorantreibt. Besonders in Phasen der Unsicherheit – wenn Ziele und Rollen noch nicht klar sind – betrachtet er Empowerment als Schlüsselkompetenz.
In großen Organisationen existieren viele Mikrokulturen nebeneinander. Die Kunst besteht darin, Vielfalt zuzulassen und dennoch eine gemeinsame Richtung zu halten. „In dieser Vielfalt,“ sagt Herr Busch, „entsteht Innovation – insbesondere, wenn Menschen über Abteilungsgrenzen hinweg lernen, selbst zu gestalten.“
Digitalisierung und Lernen – der Mensch im Mittelpunkt
Ein weiteres Kernthema ist der Umgang mit Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz (KI). Herr Busch macht deutlich, dass Technologie allein keine Transformation bewirkt – sie braucht den Menschen, der sie versteht, anwendet und weiterentwickelt.
Das Unternehmen investiert daher nicht nur in Infrastruktur, sondern vor allem in Lernräume. Herr Busch berichtet, dass bei der Einführung von generativer KI in der Produktentwicklung alle Teammitglieder eine Woche freigestellt wurden, damit alle EntwicklerInnen die neuen Werkzeuge ausprobieren, Erfahrungen austauschen und Anwendungsfälle gemeinsam entwickeln konnten.
Diese Initiative kostete Millionen, war aber bewusst als Investition in Menschen gedacht.
„Der Return on Investment kommt von den Menschen, nicht von der Technik“, betont Herr Busch.
Er sieht darin einen kulturellen Wandel: Früher stand Kontrolle im Mittelpunkt, heute gehe es darum, Lernen und gegenseitige Unterstützung zu fördern.
„Nicht Menschen werden durch KI ersetzt – sondern diejenigen, die nicht lernen, mit ihr umzugehen.“
Damit werden Empowerment und Lernen zu zwei Seiten derselben Medaille – beide brauchen Vertrauen, Zeit und den Mut, Fehler zuzulassen.
Führung als Ermöglichen
Herr Busch versteht Führung als Ermöglichen, nicht als Kontrollieren. Empowerment ist für ihn gelebte Praxis: Menschen Verantwortung geben, sie stärken, wenn sie Initiative zeigen, und Strukturen schaffen, die Lernen und Handeln erlauben.
Er beobachtet in seinem Unternehmen einen klaren Kulturwandel – weg vom reinen Befehlsempfang, hin zu Selbstverantwortung, Kooperation und Vertrauen.
Sein Stresstipp:
Fünf tiefe Atemzüge, die einem lange Zeit zum Ausatmen lassen und
der Aufenthalt im Grünen, denn das Grün der Bäume sorgt über die Augen für die Beruhigung des Gehirns. Wer Wald spazieren geht und das Grüne sieht, der hilft Kopf und Seele, das beeinflusst die Psyche positiv.